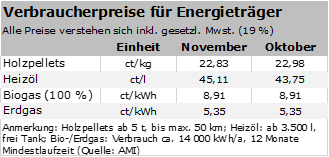Mo, 21.12.2020
Sonderedition zur Verabschiedung des EEG 2021: Bundestag mit etlichen Änderungen
Info Bioenergie
Sonderedition zur Verabschiedung des EEG 2021: Bundestag mit etlichen Änderungen
Die Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD haben sich auf die Endfassung der EEG-Novelle 2021 geeinigt. Im Vergleich zum Kabinettsbeschluss aus dem September werden nochmals umfangreiche Änderungen am Gesetz vorgenommen (hier). Das Gesetz wurde am 17. Dezember im Bundestag und am 18. Dezember im Bundesrat verabschiedet und wird dann am 01. Januar 2021 in Kraft treten. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
Bioenergie
- Das jährliche Ausschreibungsvolumen im regulären Segment wird von 350 auf 600 MW pro Jahrangehoben. Der Start der 50-Prozent-Südquote wird auf 2022 verschoben. Die jährliche Ausschreibungsmenge für Biomethananlagen bleibt bei 150 MW und wird auch erst ab 2022 auf den Süden beschränkt.
| 2021-2022 | 2023-2028 | |
| EEG 2017 | 200 MW/a | – |
| EEG 2021: Reguläres Segment | 600 MW/a | 600 MW/a |
| EEG 2021: Segment für Biomethan im Süden | 150 MW/a | 150 MW/a |
- Kleine Neu- und Bestandsanlagen bis zu einer installierten Leistung von 500 kW erhalten in den Ausschreibungen zusätzlich einen Bonus von 0,5 ct/kWh auf den Zuschlagswert. Der Bonus soll auch für Anlagen bis 150 kW gelten, also Anlagen in der Festvergütung. Die Erhöhung der Gebotshöchstwerte um ca. 2 ct/kWh für Neu- und Bestandsanlagen bleibt bestehen.
| Jeweils für 2021 | EEG 2017 | EEG 2021 |
| Neuanlagen im regulären Segment | 14,3 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
| Bestandsanlagen im regulären Segment | 16,24 ct/kWh | 18,4 ct/kWh |
| Segment für Biomethan im Süden | – | 19 ct/kWh |
- Für unterdeckte Ausschreibungen für Neu- und Bestandsanlagen wird ein neues Zuschlagsverfahren eingeführt, das zur Folge hat, dass dann nur noch 80 % der Gebotsmenge bezuschlagt werden. Wird das Volumen in einer Ausschreibung nicht ausgeschöpft, erhalten also 20 % der Gebotsmenge keinen Zuschlag, selbst wenn sie unter dem Gebotshöchstwert bleiben (sog. endogene Mengensteuerung).
- Der Flexibilitätszuschlag wird für frühere Bezieher der Flexibilitätsprämie beschränkt und nur noch für Leistung gewährt, die gegenüber der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie zusätzlich flexibel bereitgestellt wird.
- Die Sondervergütungsklasse für Güllevergärung wird nicht nochmal überarbeitet. Damit wird nur die Begrenzung der Bemessungsleistung auf 75 kW aufgehoben. Da die Begrenzung der installierten Leistung auf 150 kW beibehalten sowie die Pflicht zur Flexibilisierung aufrechterhalten wird, können de facto keine Gülleanlagen mit deutlich höherer Bemessungsleistung als bisher gebaut werden. Ab einer installierten Leistung von 100 kW erhalten neue Anlagen den Flexzuschlag.
- Die Verordnungsermächtigung für eine Anschlussvergütung für bestehende Gülleklein- und Biogasanlagen, die nach Auslaufen des ersten Vergütungszeitraums auf Güllevergärung umrüsten wollen, bleibt und wird nicht direkt im Gesetz geregelt.
- Güllekleinanlagensollen künftig 50 statt nur 45 % ihrer installierten Leistung als Bemessungsleistung vergütet bekommen. Für alle anderen Biogasanlagen bleibt die Verschärfung von 50 auf 45 %. Die Flexibilitätsanforderungen für Festbiomasseanlagen werden entschärft und betragen künftig nur noch 75 statt 65 %.
- Für neu bezuschlagte Anlagen werden Qualitätskriterien an die Flexibilität eingeführt. Biogasanlagen, die über mehr als ein BHKW verfügen, müssen an mind. 4.000 Viertelstunden im Jahr mind. 85 % ihrer installierten Leistung abrufen.
- Altholz-Anlagen, die zwischen 2021 und 2025 aus der EEG-Förderung fallen, sollen eine degressive Übergangsförderung erhalten.
- Außerdem bleiben u.a. folgende Regelungen aus dem Kabinettsbeschluss bestehen:
- Flexdeckel wird aufgehoben
- Flexzuschlag steigt von 40 auf 65 Euro pro kW installierter Leistung
- Realisierungsfrist für Neuanlagen steigt von 24 auf 36 Monate
- Wechselfrist in den zweiten Vergütungszeitraum sinkt von zwölf auf zwei Monate
- Maisdeckel sinkt von 44 auf 40 %.
- Agri-Photovoltaik:In die Innovationsausschreibungen wird das Segment der „besonderen Solaranlagen“ aufgenommen. Neben „Solaranlagen auf Ackerflächen bei gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau“ gehören dazu auch schwimmende PV und PV auf Parkplätzen. Die Anforderungen an dieses Segment sollen von der Bundesnetzagentur im Oktober 2021 festgelegt werden. Es werden einmalig im Jahr 2022 50 MW ausgeschrieben, die einzelnen Anlagen müssen zwischen 100 kW und zwei MW groß sein.
- Die Kulisse für Freiflächenanlagen wird nicht nochmal überarbeitet. Damit beträgt der Randstreifen an Autobahnen und Schienenwegen künftig 200 m (vorher 110 m) zuzüglich 15 m für Tierwanderungen. Die Größenbeschränkung pro Anlage wird von zehn auf 20 MW angehoben.
- Die Einspeisevergütung für neue Anlagen entfällt jetzt, wenn der Börsenstrompreis mindestens vier Stunden (vorher sechs h) negativ ist. Die Zeiträume mit negativen Strompreisen werden jetzt an den ursprünglichen Vergütungszeitraum angehängt.
- Für PV-Dachanlagen wird die Ausschreibungsgrenze jetzt nicht auf 500 kW abgesenkt, sondern bleibt bei 750 kW. Anlagen zwischen 300 und 750 kW haben die Wahl, ob sie in Ausschreibungen gehen möchten. In den Ausschreibungen ist kein Eigenverbrauch möglich, bei Eigenverbrauch wird nur die Hälfte des Stroms vergütet.
- Die optionale Anschlussvergütung bis 2027 (Jahresmarktwert minus Vermarktungskosten) für Dachanlagen, deren Vergütungszeitraum abgelaufen ist, bleibt bestehen. Die Regelung ist jetzt generell auf Anlagen bis 100 kW begrenzt.
- Die Pflicht zum Einbau eines Smart-Meters wird nicht auf eine Anlagengröße von einer kW verschärft, sondern bleibt wie im EEG 2017 bei sieben kW.
- Im Vergleich zum Kabinettsentwurf steigt das Ausschreibungsvolumen für Dachanlagen steigt pro Jahr um 50 MW, dafür werden analog 50 MW/Jahr bei den Freiflächenanlagen abgezogen.
- Beim Mieterstrom werden künftig Quartiersansätze ermöglicht. Das bisherige Kriterium des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs fällt weg. Darüber hinaus wird der Mieterstrom von der Gewerbesteuer befreit.
- Es wird eine Verordnungsermächtigung für Regelungen geschaffen, mit denen auch für PV-Freiflächenlagen Akzeptanzzahlungen i.H.v. 0,2 ct/kWh (wie bei Windkraft) an die Kommunen geleistet werden können.
- Der sog. „atmende Deckel“ wird nochmal angepasst und jetzt auf einen Zielwert von 2100 MW/Jahr (KabE: 2300) ausgerichtet. Zudem werden die Mechanismen überarbeitet.
- Für ausgeförderte Windkraftanlagen, deren Vergütungszeitraum Ende 2020 oder Ende 2021 endet, wird jetzt auch eineAnschlussregelung geschaffen, die auf Ende 2021 bzw. Ende 2022 begrenzt ist. Die Anlagen müssen dazu in neue Ausschreibungen und erhalten bis dahin einen Aufschlag auf den Strommarktwert.
- Die Akzeptanzzahlung an die Kommunen i.H.v. 0,2 ct/kWh wird eingeschränkt und darf jetzt nur noch an Kommunen im Umkreis von 2,5 km gezahlt werden. Wenn mehrere Kommunen betroffen sind, muss die Zahlung aufgeteilt werden.
Bewertung
Der Bundestagsbeschluss enthält neben zusätzlichen Verbesserungen für die Bioenergie auch Hürden. Die höheren Ausschreibungsvolumina (600 MW/Jahr) und der zusätzliche Bonus von 0,5 ct/kWh auf den Zuschlagswert für kleine Biogasanlagen sind positiv zu werten. Damit werden wichtige DBV-Forderungen aufgegriffen. Kritisch ist aber das neue Zuschlagsverfahren bei unterdeckten Ausschreibungen. Die Wirkung der erhöhten Gebotshöchstwerte wird so wohl deutlich ausgebremst. Auch die Regelung, wonach der Flexibilitätszuschlag für frühere Bezieher der Flexibilitätsprämie beschränkt ist, wirkt sich nachteilig aus.
Leider enthält das EEG trotz intensiver Bemühungen des DBV keine echte Überarbeitung der Sondervergütungsklasse für die Güllevergärung. Hier bietet sich aber die Gelegenheit, diese Forderung nochmal aufzugreifen, wenn vsl. im Frühjahr eine Anhebung der Ausbauziele im EEG neu adressiert wird.
Bei der Photovoltaik ist die Ausweitung der EEG-Umlagebefreiung auf Anlagen bis 30 kW zu begrüßen. Zudem gilt die Regelung jetzt auch für ausgeförderte Anlagen und schafft damit für viele Betreiber Weiternutzungsoptionen. Zudem wird ein interessantes Segment für Agri-PV geschaffen. Insgesamt stärkt der Bundestag den Ausbau von PV-Dachanlagen, der Seitenrandstreifen an Verkehrswegen für Freiflächenanlagen bleibt aber leider unverändert.